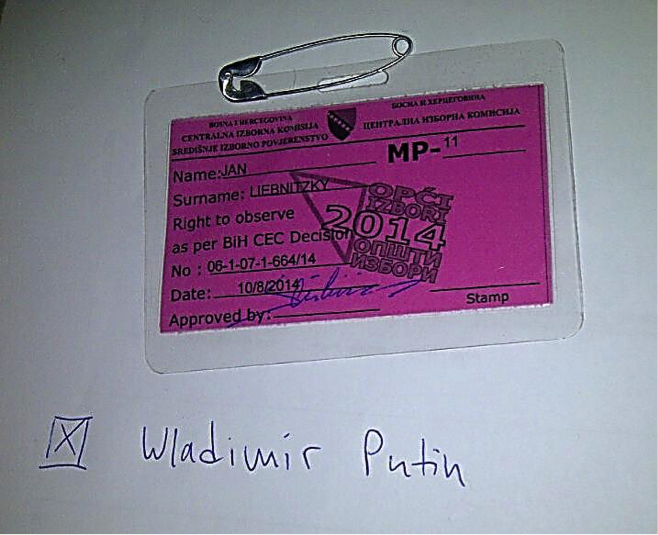Gewinner? Verlierer? Zweck? – Warum die TV-Debatte zwischen Alex Salmond und Alistair Darling keine Wähler bewegt hat
Von Jan Eichhorn.

Image © Scottish Parliamentary Corporate Body – 2012. Licensed under the Open Scottish Parliament Licence v1.0.
Letzten Dienstag (5. August) konnten wir einem Ereignis beiwohnen, das ein Highlight der Kampagnen auf dem Weg zum schottischen Unabhängigkeitsreferendum im September werden sollte. Der Erste Minister Schottlands, Alex Salmond, von der Schottischen Nationalpartei debattierte mit dem Leiter der „Better Together“ Kampagne, Alistair Darlin. Im Vorfeld wurde viel über dieses Duell geschrieben: Es war klar, dass das Hauptziel für beide Kampagnen das Überzeugen von noch Unentschlossenen war — oder zumindest das Erreichen derjenigen, die in ihrer Meinung noch nicht ganz gefestigt sind. Diese Gruppe, die eventuell auch ihre Meinung noch ändern würde, macht bis zu ein Viertel der Wählerschaft aus. Sie sind diejenigen, die eventuell noch auf die eigene Seite gezogen werden können (obwohl die meisten schon eine Tendenz haben). Es war klar, wenn man diese Gruppe nicht erreichen kann, wird es schwer, diese zukünftig zu überzeugen.
In TV-Debatten richtet sich die Aufmerksamkeit natürlich stark auf die Diskutanten und die Einschätzung ihrer Leistung, die nicht nur auf Basis der Qualität ihrer Argumente sondern auch insbesondere auf Grundlage ihres persönlichen Auftretents evaluiert wird. Vor der Debatte gab es einen scheinbaren Konsens in vielen Medien: Alex Salmond sei der bessere Redner und werde deutlich besser abschneiden als der weniger charismatische Alistair Darling, der wegen seiner Reserviertheit (oder auch Langeweile in weniger subtilen Kommentaren) kritisiert wurde. Gleichzeitig wurde Salmond aber auch als stärker unter Druck stehend dargestellt, da „Yes“ in den Umfragen hinten lag, sodass er mit einem Riesenvorsprung gewinnen müsste, um dieses zu verändern, während Darling ein Unentschieden reichen würde.
Das Ergebnis am Ende des Abends: Die meisten Kommentatoren nannten es insgesamt ein Unentschieden ohne klaren Sieger — aber mit einer positiven Einschätzung von Alistair Darling, der angeblich überraschenderweise animiert und aggressiv war, während Salmond zeitweise sogar defensiv auftrat. Während er zeitweise staatsmännisch agierte, griff er manchmal zurück auf unglückliche Formulierungen (die Schottland-angreifenden Aliens sind dabei eines der merkwürdigsten). Die Argumente waren auf keiner Seite besonders gut und der Fokus lag erwartungsgemäß auf der persönlichen Leistung der Debattierenden.
Die Diskussion selbst war nicht herausragend. Die Hauptthemen (vorranging die Währungsfrage, aber auch Europa) sind zwar Lieblingsstreitpunkte der Kampagnen und Medien, bilden aber nicht die Themen ab, die eine wichtige Rolle für die Entscheidung der Mehrheit der Schotten spielen; vor allem nicht für die Unentschlossenen – wie wir (und andere) in verschiedenen Studien gezeigt haben. Die Themen, auf die sich in der Debatte am meisten bezogen wurde, waren die, denen die Kampagnenanhänger große Aufmerksamkeit schenken. Das sind jedoch nicht die Probleme, für die sich der Großteil der Unentschlossenen interessiert. Hauptstreitfelder für die Unentschlossenen (wie Wirtschaftspolitik, Rentenpläne und der Umgang mit dem Nordseeöl) wurden zwar zum Ende hin angesprochen, leider war die Zeit um, bevor man stärker ins Detail hätte gehen können. Wenige unetschlossene Wähler fanden diese Diskussionen hilfreich. Während Alex Salmond die Möglichkeit über tatsächliche politische Pläne zu sprechen verschenkte und stattdessen rein rhetorische Aspekte („Project Fear“) in seiner ersten Frage ansprach, redete Alistair Darling fast ausschließlich über die obengenannten Themen, ohne auf die wichtigen Fragen, die unentschlossene Wähler diskutieren wollten, einzugehen.
Allerdings war nicht nur die Qualität der Debatte begrenzt, auch die Kommentare danach waren nicht besser. Das lag vor allem auch daran, dass nur wenige Medienvertreter die Konzentration auf Themen, die nicht wichtig für die Unentschlossenen waren, kritisierten, aber gleichzeitig diese Gruppe als Fokus für die Politiker herausstellten – das liegt sicherlich auch daran, dass viele Medien weiter die Fragen diskutierten, die viele akademische, politische und mediale Kreise besonders wichtig fanden. Sie ignorierten jedoch, was die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler vorrangig interessierte. Mir kam es oft so vor, als ob der Tenor und Ablauf der Analyse des Abends schon vorher festgeschrieben stand: Alex Salmond wurde in einer Lage dargestellt, in der er — ohne ein Wunder — nicht gewinnen konnte, da nur ein grandioser Triumph als Sieg gegolten hätte. Während viele seiner Argumente und verfehlten Gelegenheiten auch tatsächlich Kritik verdienten, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass die Präsentation der Situation und die Überraschung über die Balance der Leistungen der Diskutanten durchgängig übertrieben war.
Alistair Darling ist kein drittklassiger Akteur in der britischen Politik. Er was Schatzkanzler (Finanzminister) und damit eines der wichtigsten Kabinettsmitglieder unter Premierminister Gordon Brown. Er wurde 1987 das erste Mal ins britische Parlament in Westminster gewählt und hat dort als Abgeordneter und Minister in einem der debattenstärksten Parlamente heftige Schlagabtausche geführt und unter anderem den Haushalt in der Finanzkrise verteigen müssen. Ihn als Figur zu porträtieren, die nur verlieren konnte, spielte seine Fähigkeiten im Vorfeld stark herunter (wenn man zurückschaut und seine frühen Kampagnenreden aus den 1980ern ansieht, gewinnt man ein Verständnis dafür, wie gut er verschiedene Rollen in verschiedenen Situationen ausfüllen kann).
Ich finde es mehr als unglücklich, wenn die Leistung eines Politikers in einer Debatte dann als besser eingeschätzt wird, wenn er den Gegner schon im Eröffnungsstatement persönlich angreift, weil das angeblich Leidenschaft zeigt. Während die Jubelrufe aus dem Publikum auf beiden Seiten eher die Leute repräsentierten, die ihre Meinung gefestigt hatten und sich nun von der Person, die sie sowieso unterstützten, bestätigt darin fanden, mussten diejenigen, die noch immer versuchen zu entscheiden, welchen Fakten sie eher Vertrauen schenken, wohl still hoffen, dass die Debatte sich irgendwann weiterentwickeln würde. Wenn die nächste Ausgabe (voraussichtlich am 25. August in der BBC) irgendetwas für die, die sich ernsthaft noch mit Kernfragen auseinandersetzen wollen, erreichen soll, müssen die Kandidaten ihre alten, verbrauchten Floskeln weglassen und sich weniger darauf konzentrieren, ihre eigenen Unterstützer zufriedenzustellen (die sowieso von ihnen überzeugt sind). Außerdem müssen aber auch die Kommentatoren in Medien und Forschung mit der Debatte in einer Art und Weise umgehen, die nicht vorprogrammiert ist, um die Analysen nach den Diskussionen substantieller werden zu lassen als einfache Bestätigungen der Stories, die sie vorher kreiert haben.
–
Dr Jan Eichhorn ist der Forschungsdirektor von d|part, unterrichtet Social Policy an der University of Edinburgh und koordiniert Forschungsprojekte zu den öffentlichen Einstellungen zum Referendum in Schottland innerhalb des „Future of the UK and Scotland“ Programms des Economic and Social Research Councils, durch den die Forschung finanziert wird.
Disclaimer
Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten und Meinungen entsprechen denen des Autors.